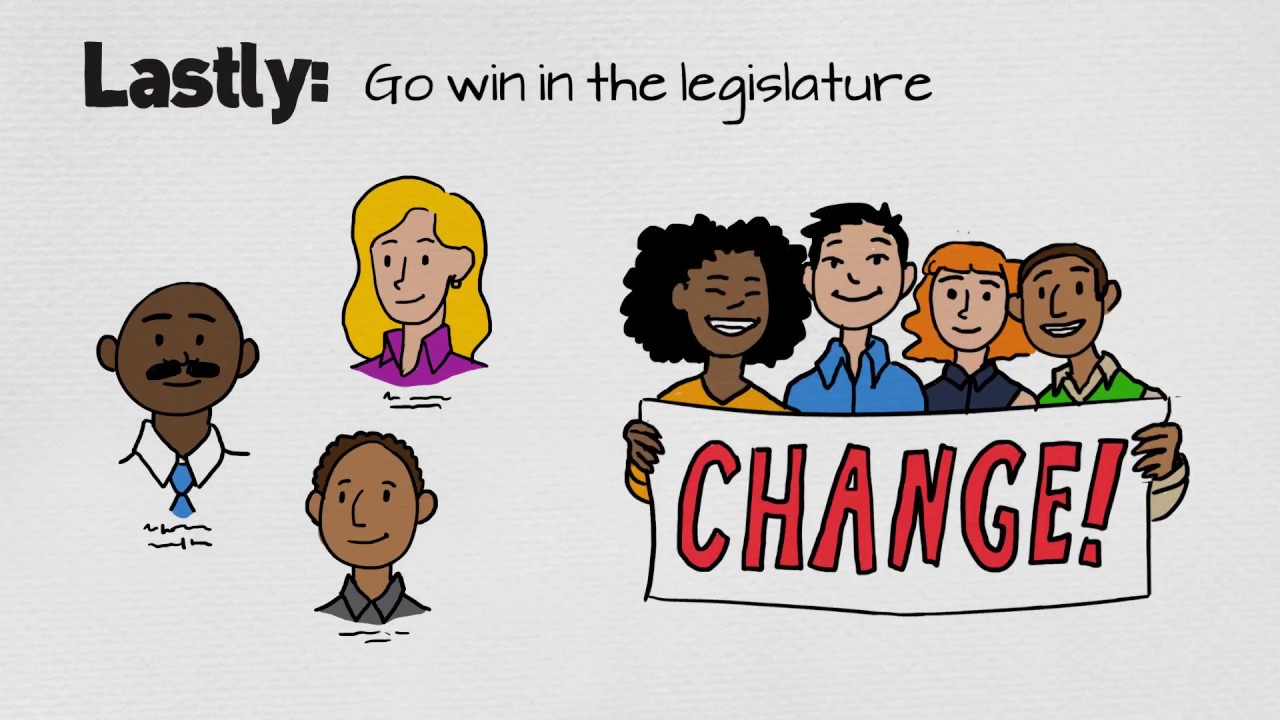Paula Fehringer, Lena Bichler, Jonas Bücherl, Saad Elalaoui
1. Einleitung
Das vorliegende Video ist ein Appell der ADRA an politische Entscheidungsträger. 2019 rief die Hilfsorganisation, welche weltweit Projekte in der Entwicklungsarbeit durchführt, die Kampagne mit dem Titel „Every child. Everywhere. In school.” ins Leben. Die Organisation fordert, dass keinem Kind die Bildung verweigert werden dürfe und ruft global dazu auf, die Petition mit einer Unterschrift zu unterstützen. Das Ziel: eine Millionen Unterschriften bis zum Sommer 2020 zu sammeln, um politische Führungspositionen auf die bestehenden Missstände aufmerksam zu machen und sie zum Handeln zu bewegen.
Anfang Juli konnte die Organisation den Erfolg feiern: mehr als 1 Millionen Unterschriften waren zusammengekommen. (vgl. ADRA International: 2019) Das Projekt konnte beweisen, dass durch Zusammenarbeit, eine kraftvolle Stimme für den Wandel entstehen kann. Diese Kampagne ist nur ein Beispiel für erfolgreiche Advocacy-Arbeit.
Auf den folgenden Seiten, werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was genau Advocacy Arbeit ist, wie man sie erfolgreich durchführt , welche Schwierigkeiten zu beachten sind und schlussendlich einen Blick auf weitere Advocacy-Projekte werfen.
2. Advocacy Communication in der Entwicklungsarbeit
2.1. Was versteht man unter Advocacy?
Advocacy Communication beschreibt strategische Kommunikation, die darauf abzielt, als Fürsprache für spezifische Thematiken oder Gruppen via interpersonalem, oder auch medial vermitteltem Dialog mit Entscheidungsträger*innen Einfluss auf die Politikgestaltung auszuüben. (vgl. Wilkins 2014: 57-58) Um so einen Wandel der institutionellen Strukturen herbeizuführen, die auf juristischer, administrativer sowie ökonomischer Ebene die globale Verteilung von Macht und Ressourcen regeln. (ebd.) In der Praxis eng verwandt mit Formen der Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel Lobbying, unterscheidet sich Advocacy Communication von letzteren aufgrund ihrer Zielorientierung: statt der Vermittlung politischer Partikularinteressen, wie zum Beispiel derjenigen wirtschaftlicher Akteure, geht es ihr um die Förderung des Gemeinwohls und die Herstellung sozialer Gerechtigkeit.
Historisch entsprang ihre Notwendigkeit aus einem Paradigmenwechsel. Bis in die 1970er Jahre war die vorherrschende Ansicht innerhalb der Entwicklungskommunikation, dass die Ursache für Unterentwicklung in einem Modernisierungsdefizit der entsprechenden Länder läge; ihre Bewohner könnten diese nach dem Theoretiker Rogers durch eine „Innovationsdiffusion“ überwinden: massenmedial vermittelte Information sowie die Adaption moderner Technologien würden dazu führen, traditionelle Verhaltensweisen abzulegen und Fortschritte in der Entwicklung zu machen. Gegenüber diesem ethnozentrisch-hegemonialen, top-down gerichteten Ansatz der Entwicklungskommunikation machten vornehmlich lateinamerikanische Kommunikationstheoretiker das Prinzip der Partizipation geltend: Kommunikation darf in der Entwicklungsarbeit nicht schlicht als dirigierte Anweisung zur Änderung des Verhaltens der Bevölkerung eingesetzt werden, da die Verfolgung alternativer individueller Praxen meist durch Probleme, die sich aus den jeweiligen sozialen, administrativen oder ökonomischen Rahmenbedingungen ergeben, verhindert wird. Stattdessen muss Kommunikation den Marginalisierten als Mittel dienen, ihre Positionen zu artikulieren, Probleme zu definieren, zur Unterstützung zu mobilisieren und sich Gehör zu verschaffen, um das öffentliche Bewusstsein für die Veränderung der sozialen Strukturen, wie beispielsweise der ungerechten globalen Verteilung der Ressourcen, zu sensibilisieren, in die die Lebenswelten der Individuen eingebettet sind und die ihre Geschicke determinieren. (vgl. Huesca 2008: 181-182)
Gemäß diesem Ansatz lassen sich zwei Hauptadressaten von Advocacy Communication ausmachen: Im Vordergrund stehen Entscheidungsträger*innen, die mit Informationen versorgt werden müssen, um eine angemessene Politik zu betreiben. Daneben ist auch die generelle Öffentlichkeit eine wichtige Zielgruppe, um Unterstützung für eine bestimmte Entwicklungsinitiative zu generieren und so weiteren Druck auf die Entscheidungsträger*innen auszuüben. (vgl. Malikhao & Servaes 2012: 232) Um beide Gruppen als Partner zu gewinnen, stellen die Medien ein wertvolles Instrument dar.
2.2. Medien als Multiplikatoren von Advocacy
Gelungene Advocacy Communication macht sich die Agenda-Setting-Funktion der Medien zu Nutze: Berichte und Beiträge über die eigene Initiative zu veröffentlichen verhilft ihr zur benötigten Aufmerksamkeit und Unterstützung seitens der Öffentlichkeit und der Entscheidungsträger*innen, denn die Themenagenda der Medien beeinflusst, was das Publikum für relevant erachtet. Um Zugang zu verschiedenen Medienportalen zu erlangen, empfiehlt es sich, bei der Nachrichtenkonstruktion gewisse Faktoren zu beachten, um sie für die Medien attraktiv zu gestalten: Inhalte müssen eine gewisse Relevanz für das öffentliche Interesse bieten, andere Aspekte wie Lokalität, Sensation, Konflikt, Negativität, Prominenz oder Personalisierung können integriert werden, wenn sie der zu behandelnden Thematik angemessen sind. Zuletzt ist noch das Framing der zu beseitigenden Probleme in den Medienbeiträgen zu beachten. Statt sie als Angelegenheiten der persönlichen Verantwortung zu markieren, erscheint es zweckmäßiger, auf die kollektiven und strukturellen Ursachen des Problems hinzuweisen und Lösungen in Form eines konkreten politischen Wandels zu präsentieren. (vgl. Wallack 1994: 271-272)
3. Die Wirkungsfelder von Advocacy
Was kann erfolgreiche Advocacy Arbeit bewirken?
Das grundsätzliche Ziel von Advocacy ist Zugang zu Entscheidungsträgern zu bekommen, um diese hinsichtlich einem Thema und Anliegen einer Gruppe oder der Gesellschaft zu sensibilisieren und zu beeinflussen. (vgl. Coulby 2010: 6) Einen Wandel herbei zu führen wird nicht funktionieren, wenn man es nicht schafft die Ideen und Anliegen effektiv zu kommunizieren. (ebd.) Oft ist für diese Kommunikation die Advocacy-Arbeit von Organisationen nötig. Welche Wirkungen Advocacy erzielen kann gliedert die Handreichung von Brot für die Welt wie folgt.: (vgl. Krisch, 2012: 10)
Das primäre Ziel von Advocacy ist der politische Wandel. (vgl. Krisch 2012: 10 f.) Einen Wandel in der Politik herbeizuführen ist komplex und benötigt eine gute strategische Herangehensweise. (ebd.) Um durch Advocacy Arbeit einen politischen Wandel zu erzielen, müssen die Strategien und Maßnahmen an den geeigneten Stellen angewendet werden und gezielt Entscheidungsträger angesprochen werden. (ebd.) Steht man am Beginn eines Projektes ist es beispielsweise ratsam die Gesellschaft in den Diskurs durch Agenda-Setting einzubinden. (ebd.) Durch die Mobilisierung können Kampagnen Druck auf Politiker und Entscheidungsträger ausüben und einen Wandel erzielen. (ebd.) Ist man jedoch mit dem Projekt weiter und möchte bei Gesetzesänderungen mitwirken, ist Lobbyarbeit notwendig. (ebd.) Die nachfolgenden Wirkungsbereiche sind zudem mitverantwortlich für die Erreichung der gesetzten Ziele und eines politischen Wandels.
Im engen Zusammenhang mit dem politischen Wandel steht der Ausbau von demokratischen Gestaltungsspielräumen, denn viele Länder auf der Welt leben noch in nicht-demokratischen politischen Systemen. (vgl. Krisch 2012: 11 f.) Auf Grund dessen haben diese Personen Gruppen oftmals keine oder nur eingeschränkte Möglichkeiten an einem Wandel teilzuhaben. Durch Advocacy kann man die Interessenvertretung der Bürger durch zivilgesellschaftliche Organisationen stärken und den betroffenen Gesellschaften zu einer Stimme verhelfen. (ebd.)
Informiere dich:
Oxfams Partner STOP-SAHEL setzten sich nach dem Militärputsch in Mali 2012 für die Wiederherstellung einer funktionierenden Demokratie ein. Informationen zu diesem Projekt findet ihr hier
Advocacy-Arbeit wirkt nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch auf der Gesellschaftsebene und führt zu Veränderungen sozialer Normen. (vgl. Krisch 2012: 12) Durch Aufklärungsarbeiten und die Sensibilisierung über gesellschaftsrelevante Themen gibt man Personen und Gruppen die Möglichkeit über soziale Normen zu reflektieren und Verhaltensänderungen hervorzurufen. (ebd.)
Informiere dich:
Das Bündnis #unteilbar setzt sich für eine solidarische und offene Gesellschaft ein. Mithilfe von Plakaten, öffentlichen Aktionen und Demonstrationen mit Kundgebungen möchten sie die Öffentlichkeit über Rassismus und soziale Ungleichheit aufklären und ermöglichen somit einen öffentlichen Diskurs. Auf ihrem YouTube Kanal verbreitet das Bündnis #unteilbar Aufklärungsvideos mit Kundgebungen und Aufrufe zu Demonstrationen (Bündnis #Unteilbar, 2020).
Zum Prozess des Wandels zur Förderung des Gemeinwohls und zur Herstellung sozialer Gerechtigkeit gehört auch Empowerment, die Stärkung von benachteiligten Personen und Gruppen. (vgl. Krisch 2012: 12) Advokaten verhelfen betroffenen Menschen, ihre Anliegen und Themen selbst zu kommunizieren und sich selbst zu vertreten. (ebd.)
Informiere dich:
Der Podcast von #unteilbar thematisiert Feminismus und Gleichberechtigung unabhängig vom Geschlecht (Bündnis #unteilbar, 2019)
Advocacy wirkt auch in Form der Kapazitätsbildung zivilgesellschaftlicher Organisationen, denn die Organisationen selbst benötigen Unterstützung und das nötige Know-How. (vgl. Krisch 2012: 12 f.) Dazu gehört das sammeln von praktischen Erfahrungen, Expertenwissen über die Arbeit von Advokaten, der Bezug auf anerkannte Werte und die Zusammenarbeit in demokratisch organisierten Netzwerken. (ebd.)
Informiere Dich:
Was eine Zusammenarbeit von Organisationen hervorbringen kann, könnt ihr bei der Neuen deutschen Organisation nachlesen. Sie haben sich an der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen beteiligt und gemeinsam mit 40 Migrantenorganisationen eine Antirassismus Agenda 2025 erstellt (neue deutsche organisationen e.V., 2020).
Um Ziele zu erreichen, die nicht in dem eigenen Handlungsbereich liegen, benötigt man als Advokat*in die Unterstützung von Dritten und ein großes Netzwerk. (vgl. Krisch 2012: 13) Advocacy Maßnahmen haben somit auch das Ziel ein Netzwerk aufzubauen und relevante Kontakte zu pflegen. (ebd.) Um beispielsweise eine Gesetzesänderung in der EU-Politik zu erzielen, werden Unterstützer in der Politik benötigt, die das Anliegen vertreten und sich dafür einsetzen.
Informiere Dich:
Die Neue Deutsche Organisation ist eine Advocacy-Organisation in Deutschland. Sie sind Mitglied im Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft. Informationen hierzu findet ihr hier: (neue deutsche organisationen e.V., o.A. )
Neben den großen Wirkungsbereichen des politischen Wandels und der gesellschaftlichen Normen ist ein großer Wirkungsbereich von Advocacy-Organisationen die Verbesserung von Unternehmenspraktiken (vgl. Krisch 2012: 13). Durch die Globalisierung agieren Konzerne international und schrecken auch nicht davor zurück die nicht humanitären Gesetze und Regelungen zu nutzen. (ebd.) Deshalb versucht auch Advocacy dort zu wirken, indem sie ihre Forderungen an die Unternehmen selbst oder die staatlichen Institutionen richten. (ebd.)
Informiere Dich:
Das Projekt von HEKS, den indigenen Völkerstamm Guarani-Kaiowá zu unterstützen, zeigt auf wie Advocacy-Arbeit auf lokale Unternehmen wirken kann. (vgl. Gisler, o.A.)
Anhand dieser Wirkungsfelder kann man als Advokat*in sein langfristiges Ziel und die entsprechenden Teilziele definieren. Diese Ziele und Teilziele können durchaus über mehrere Wirkungsbereiche gehen, denn sie lassen sich nicht klar trennen. Denn das primäre Ziel von Advocacy ist der politische Wandel und um diesen zu erreichen, wird es beispielsweise auch nötig sein einen demokratischen Gestaltungsspielraum zu schaffen oder mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten.
4. Planung, Monitoring & Evaluierung von Advocacy
Wie schafft man es die Ziele von Advocacy zu erreichen?
Zunächst ist zu sagen, dass es bei der Advocacy-Arbeit nicht den „einen richtigen” Weg gibt, sondern man verschieden vorgehen kann. (vgl. Bond: 3) Abhängigkeit von den politischen und kommunikationswissenschaftlichen Zielen unterscheiden sich die Arbeitsschritte und deren Reihenfolge. (vgl. Krisch 2011: 15) Die folgende Abbildung ist eine mögliche Darstellung des Advocacy-Zyklus’ von Maureen O’Flynn.
Im äußeren Kreis sind die Prozesse von der Vorüberlegung über Recherche, Strategieentwicklung, Netzwerkbildung und Umsetzung bis zur wiederholten Situationsanalyse dargestellt. Die Schrittfolgen können variieren. (vgl. Krisch 2011: 8) Im Inneren des Kreises sind die Funktionen der Datensammlung und Dokumentation sowie des Monitoring und der Evaluation dargestellt. Genauso wie der Dialog mit den Stakeholdern und Unterstützer*innen sind sie ein kontinuierlicher Prozess. (vgl. Krisch 2012: 14)
Recherche:
Recherche ist das Handwerkszeug eines jeden Wissensarbeiters. Den ersten Schritt sollte also eine gründliche Recherchephase darstellen sowie die konkrete Situationsanalyse, um einen genauen Überblick über die Problemlage zu schaffen.
Problemdefinition:
Die Problematik wird nun greifbarer, kann definiert und schlussendlich in ein konkretes Ziel umformuliert werden. Mögliche Lösungsansätze werden vielleicht hier deutlich und man kann gegebenenfalls schon herausfinden, wie die „Gegner” aufgestellt sind. (vgl. Krisch 2012: 8)
Stakeholder analysieren:
Im nächsten Schritt ist es von Bedeutung, alle Stakeholder, das heißt Individuen oder Gruppen, die das Projekt betreffen könnte, zu identifizieren. Wer sind die Betroffenen? Wer könnte unterstützend wirken? Wer sind die Gegner*innen? (vgl. BOND 2005: 3) Die Partizipation von Betroffenen sorgt für mehr Glaubwürdigkeit und ermöglicht erste Lerneffekte bei Betroffenen. (vgl. Krisch 2012: 8) Erfolgreiche Advocacy-Kommunikation macht sich Kontakte zu unterstützenden Parteien, aber auch Gegner*innen zu Nutze, um die eigenen Gestaltungsspielräume besser einschätzen zu können und auszumachen, an welchen Stellen Unterstützung von außen gebraucht wird. Allianzen und Partner stellen eine große Wichtigkeit dar. Sie können zum Beispiel bei fehlenden Ressourcen helfen. (vgl. Krisch 2012: 16)
Zielformulierung:
Nun kann ein spezifisches, messbares Ziel bzw. mehrere Zwischenziele und anschließend eine entsprechende Strategie definiert werden. (vgl. Krisch 2012: S. 15) Eine klare Aufgabenverteilung sowie die Zuständigkeit der Verantwortungsbereiche sorgt für Struktur. (vgl. BOND 2005: 5) Wichtig ist es, eine Message zu formulieren, die gut verständlich ist und überzeugend wirkt. (vgl. BOND 2005: 3)
Wie man Advocacy in sechs Schritten effektiv gestalten kann seht ihr hier:
Evaluation:
Des Weiteren sollte unbedingt eine Möglichkeit gefunden werden, das Gelingen der Strategie nachträglich einzuschätzen. (The Praxis Project: 3) Dafür sind die erhobenen Daten (Fallbeispiele, Interviews, Fotos usw.) aus der Recherchephase wichtig, um einen Vergleich zur Ausgangssituation aufstellen zu können.
Eine Möglichkeit den Erfolg einzuschätzen, kann zum Beispiel das Aufstellen wirkungsorientierte Indikatoren und Leitfragen sein. Indikatoren kann man als konkrete Meilensteine in der finalen Zielerreichung betrachten. Sie sollten am Anfang in der Planungsphase formuliert werden. Auch externe Faktoren, wie zum Beispiel die Erfolge oder Niederlagen von Gegnern, sind mögliche Indikatoren und sollten regelmäßig beobachtet werden. Leitfragen stellen eine weitreichende Variante dar, Erfolge zu messen.
Wie genau man schrittweise in der Evaluationsphase vorgeht, hat die „Handreichung für Evaluationen“ von „Brot für die Welt“ dokumentiert. (vgl. Krisch 2012: 21)
4.1 Medienarbeit
Wie erhält das Projekt Gehör in den Medien?
Voraussetzung für die Umsetzung eines Advocacy-Projekts ist, das Thema ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit zu bringen. Erst wenn die Bevölkerung erkennt, dass ein Problem besteht, wird auch die nötige Unterstützung derselben gegeben sein. (vgl. The Praxis Project: 4) Doch wie erhält man nun genau die nötige Aufmerksamkeit und Partizipation für das Projekt? Wie bereits zu Anfang erwähnt, sind Medien ein starkes Instrument, welches unbedingt genutzt werden sollte. Medien schaffen die Möglichkeit, Informationen schnell zu verbreiten und Ideen Gehör zu verschaffen. Hilfreich sind an der Stelle verschiedene Tools, um eine genaue Kommunikationsstrategie zu entwickeln. (Bsp: „Advocacy Communication: A Handbook for new Members” von Hilary Coulby, abrufbar unter
Methoden:
Es gibt eine Vielzahl an Medien, die unbedingt genutzt werden sollten, um dem Projekt Aufmerksamkeit zu verschaffen. In Abhängigkeit von der Message, die man verbreiten möchte, der Zielgruppe, die im Fokus steht und dem Gesamtziel, muss gezielt ausgewählt werden, welche Medien vielversprechend sind. (vgl. Coulby 2010: 14)
Welche Kommunikationskanäle gibt es?
Zu den wichtigsten Kanälen gehören:
- TV und Radio
- Nachrichten
- Dokumentationen
- eigene Videos
- Printmedien
- Zeitungen
- Magazine
- Onlinemedien
- Webseiten
- Blogs
- Soziale Medien
- Direkte Rede
- Präsentationen
- Seminare und Workshops
- Konferenzen (vgl. Coulby 2010: 14)
Wie erhält man die Aufmerksam der Medien?
Im Folgenden werden nun einige Beispiel-Möglichkeiten aufgezeigt, wie man Medien ausgewählt nutzen kann.
Presse, TV, Radio Nachrichten:
Um die Aufmerksamkeit dieser Medien zu erlangen, muss die Story etwas Neues beinhalten oder mit aktuellen Ereignissen verknüpft sein.
Op-Eds:
Hierbei handelt es sich um kurze Artikel, die im Meinungsteil von lokalen Zeitungen stehen. Sie beziehen sich auf Themengebiete, die in der lokalen Zeitung schon vertreten sind. (vgl. The Praxis Project: 4)
Internet Kampagnen:
Mit wenigen Kosten können Videos selbst produziert werden. Diese kann man zur eigenen Webseite hinzufügen sowie Mitarbeitern und Journalisten senden, die diese verbreiten können.
Eigene Aufnahmen:
Es lohnt sich Interviews und Presseevents auf Video aufzunehmen und zu veröffentlichen oder selbst verfasste Texte auf der eigenen Webseite zu publizieren.
Ethnische/Alternative Medien:
Jene Kanäle haben oft eine große Reichweite. Daher ist es wichtig, nicht nur die lokalen Sender zu kontaktieren.
Letter to the Editor:
Einen Leserbrief ist hilfreich, um die Story auf die Publikums-Agenda zu bringen. Herausgeber sind oftmals offen für weitere Informationen aus einem Themenbereich von Experten und Leitern einer Community. (vgl. The Praxis Project: 4)
4.2 Das Wirkungsgefüge von Advocacy
Welche Schwierigkeiten und Probleme können auftreten?
Da Advocacy-Arbeit solch ein komplexes Wirkungsgefüge ist, haben Projektakteure nur bedingt Kontrolle über die Entwicklung des Projekts. Externe Faktoren haben einen großen Einfluss und können möglicherweise Ziele behindern. Daher muss man mögliche, sich ergebende Schwierigkeiten bedenken.
Welche Schwierigkeiten könnten das sein?
- Gegner
Man sollte während der Durchführung des Projekts nicht vergessen, die Gegenparteien im Blick zu behalten. Im Idealfall können diese mit besserem Verständnis der Situation zu Partnern werden. - Man verliert den Fokus
Klare Ziele bzw. Zwischenziele, genaue Aufgabenverteilung und eine intensive Beobachtung sowie Dokumentation des Geschehens sind ungemein wichtig.
Weshalb ist dieses Wirkungsgefüge schwer zu kontrollieren?
Externe Faktoren haben einen großes Einfluss auf Advocacy-Projekte und können die Ziele behindern.
Theory of change:
Mit Veränderungen sollte also unbedingt gerechnet werden. Eine Möglichkeit die Übersicht trotz dessen zu behalten, bietet die Theory of Change. Durch das Aufstellen von Wirkungshypothesen, können Aussagen darüber getroffen werden, wie Stakeholder möglicherweise reagieren könnten. In manchen Fällen ist es dann notwendig die Stratgégie zu verändern und an sich wandelnde Rahmenbedingungen anzupassen. Dennoch ist es wichtig einen konkreten Plan vor der Ausführung zu entwickeln.
5. Fallstudien
5.1 Eine qualitative Studie zur Bekämpfung von Tuberkulose in Pakistan mithilfe von Advocacy
Rahmen
Pakistan ist ein Land mit niedrigem mittlerem Einkommen, es hat eine hohe TB-Inzidenz und -Prävalenz und es belegt den achten Platz unter den 22 Ländern mit hoher TB-Belastung weltweit. Im Rahmen des überarbeiteten Nationalen Tuberkulose-Kontrollprogramms (NTP) bemüht sich das Land seit 1995, diese Belastung zu verringern. ACSM wurde 2005 in die Länderstrategie aufgenommen. Mit 180 Millionen Einwohnern, großen sozioökonomischen Unterschieden und gemeldeten sozioökonomischen Unterschieden -kulturelle und verhaltensbezogene Hindernisse für Diagnose und Behandlung. Das Land bietet Herausforderungen und Möglichkeiten für die Untersuchung von ACSM und seiner Rolle bei der TB-Kontrolle (vgl. Haq und Al. 2013 : 394)
Ziele
- Wie werden Bevölkerungsgruppen durch ACSM Kampagnen engagiert ?
- Inwieweit konnten sie Dienste und gewünschte Verhaltensweisen fördern ?
- Wie könnten diese Kampagnen verbessert werden ?
- Methoden
- 13 Zielgruppen, 36 Interviews.
Es werden Diskussionen zwischen den Zielgruppen durchgeführt wenn die Befragten homogen waren, sowie Individuelle Interviews.
Es wurde auf die Hauptfragen geachtet, gefolgt von Unterfragen und Sonden.
Offene Fragen, die zur Diskussion führen würden, anstatt Ja-Nein Fragen bildeten den Hauptteil des Interviews.
Alle Gespräche wurden in Urdu geführt, mit Ausnahme von drei TB-Patienten in Jafrabad und Haripur, für den ein Paschtu-Dolmetscher engagiert war.
Ergebnisse
- Engaging the populations.
TB-Einrichtungen wurden durch die Gründung einer Marke gefördert für TB und TB Pflege durch die Massenmedien.
Internationale und nationale NGOs wurden auf zentraler, Provinz- und Distriktebene sowie lokale NGOs einbezogen und Community-basierte Organisationen auf Community-Ebene.
Religions- und Bildungseinrichtungen wurden engagiert, um die lokalen kulturellen, ethnischen und wirtschaftlichen Unterschiede anzugehen.
- Outdoor advertising and public events:
Outdoor-werbung wurde wie Werbetafeln verwendet und öffentliche Veranstaltungen organisiert, darunter Festivals, Sport, Debatten sowie religiöse und religiöse Veranstaltungen.
- Programme effectiveness :
TB-Patienten gaben an, das nächstgelegene TB-Zentrum kennengelernt zu haben, als sie aktiv nach Informationen über Behandlungsleistungen suchten.
5.2 Studie über die Effektivität der Advocacy-Arbeit zur Bekämpfung von Tuberkulose
Die Massenmedien- und Community-basierten „Stop TB“ -Kampagnen wurden initiiert, um das Wissen über die Diagnose, Behandlung und Prävention von TB zu verbessern. Ziel war es, Gemeinden und Menschen mit TB zu befähigen, sich aktiv mit Diagnose- und Behandlungsprogrammen zu befassen (vgl. Turk und al. 2013 : 2).
Die Kampagnen richteten sich an Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren, die in städtischen und ländlichen Gebieten leben.
Advocacy Herausforderungen (WHO)
- Verbesserung der Erkennung von Fällen und der Einhaltung der Behandlung.
- Verringerung von Stigmatisierung und Diskriminierung.
- Stärkung der TB-Patienten.
- Mobilisierung der Ressourcen und des politischen Engagements zur Bekämpfung der Tuberkulose.
- Methoden
- Datenerhebung von 2400 Teilnehmern aus verschiedenen Distrikten in Pakistan.
- Das Erhebungsinstrument bewertet soziodemografisch Hintergrund- und Haushaltsinformationen, Rückruf der ACSM-Massenmedien- und Community-basierte TB-Kampagnen und TB Kenntnisse.
- Die Umfrage wurde "Workshoped", um potenziell mehrdeutige Formulierungen zu identifizieren und sicherzustellen, dass alle Prtokole verstanden werden.
Ergebnisse
- 3 Kategorien von Befragten:(1)Befragte, die über ACSM-Aktivitäten in den Medien und in der Community informiert sind.(2)Befragte, die nur über ACSM-Aktivitäten in den Medien informiert sind.(3)Befragte, die über keine ACSM-Aktivitäten informiert sind.
- Das Kampagnenbewusstsein war je nach geografischer Lage der Befragten und selbst gemeldeter Alphabetisierung unterschiedlich.
- Befragte, die über keine ACSM-Aktivitäten informiert sind neigen dazu, weniger Kenntnisse über TB und weniger positive Einstellungen zur TB-Behandlung zu haben als die anderen, die mehr ACSM-Bewusst sind.
- Die am meisten bevorzugten Informationsquellen über TB waren Rundfunk- und Printmedien, gefolgt von Sozialarbeitern im Gesundheitswesen und Referenten in der Gemeinde.
Fernsehwerbung von NTP Pakistan
6. Digitale Advocacy Unter deutschen Stiftungen (November 2013)
Ziel dieses Projekts ist es festzustellen, welche Sozialen-Medien-Kanäle von deutschen Stiftungen genutzt werden und wie sie Facebook nutzen, um mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen ist es von Interesse, die auf Facebook angewandte Advocacy-Taktik zu betrachten. Darüber hinaus soll in dieser Studie beantwortet werden, ob für Twitter eingerichtete Kommunikations- und Advocacy-Frameworks auch auf Facebook-Posts angewendet werden können.
Stiftungen spielen eine wichtige Rolle in der modernen Zivilgesellschaft, indem sie Bildung, Forschung, Gesundheitswesen oder Kunst- und Kulturinstitutionen unterstützen. Der dritte Sektor ist in Deutschland mit 34% der in den letzten 10 Jahren gewachsen. Im Jahr 2012 hatten nach Angaben des Verbandes Deutscher Stiftungen rund 70% der Förderstiftungen und 44% der Betriebsstiftungen keine Webseite (vgl. Bürger 2015 : 1).
Die Stichprobe umfasst:
52 Bildungsorganisationen
45 gemeinnützige Organisationen
25 Organisationen des menschlichen Dienstes
23 Gesundheitsorganisationen
17 Kunst- und geisteswissenschaftliche Organisationen
14 Umweltorganisationen
13 sozialwissenschaftliche Organisationen
9 religiöse Organisationen, 9 Entwicklungsorganisationen
8 Organisationen, die sich auf Wissenschafts- und Technologiefragen konzentrieren
Die Beiträge wurden mithilfe eines Facebook-Listen-Feeds gesammelt, der alle deutschen Stiftungen auf Facebook im Zeitraum vom 18. bis 24. November 2013 enthielt.
Soziale Medien von deutschen Stiftungen genutzt
- Facebook wird von jeder Stiftung in der Stichprobe verwendet, während Twitter von 90 Stiftungen, YouTube von 41 und Google+ von mindestens 33 Stiftungen verwendet wurde.
- Stiftungen, die sich mit Bildungsthemen befassen, verließen sich mehr auf Facebook als Medium, um ihre Botschaft zu vermitteln, während Stiftungen, die sich mit Umweltthemen befassten, Twitter fast genauso häufig nutzten wie Facebook.
- Die Anzahl der Fans war nicht gleichmäßig auf die Stiftungen verteilt. Die fünf Stiftungen, die am häufigsten postierten, hielten die Hälfte aller Fans, wobei die durchschnittliche Anzahl der Fans 5526,16 betrug.
Strategien zur Einbindung von Stakeholdern
- Über die Hälfte der auf Facebook veröffentlichten Nachrichten deutscher Stiftungen lassen sich unter „Informationen“ zusammenfassen, 26,82% der Beiträge wurden der Funktion „Community“ zugeordnet, während nur jeder fünfte Beitrag eine „Aktion“ enthielt. "Anerkennung und Dank geben" wurde nicht sehr oft verwendet.
- "Danksagungen für aktuelle und lokale Ereignisse" wurden am häufigsten verwendet, um Beziehungen zu Fans aufzubauen.
- "Werbung für eine Veranstaltung" wurde am häufigsten in Kombination mit der "Aktions" -Funktion eines Beitrags verwendet.
7. Deutsche Organisationen, die Advocacy Arbeit leisten
Plan International Deutschland e.V.
8. Toolbooks
Plan International Deutschland e.V. (Plan International Deutschland e.V., 2014)
The Community Tool Box (Center for Community Health and Development, o.A.)
Coulby,Hilary (Coulby, o.A.)
Literaturverzeichnis
-
ADRA International 2019, (2019): o.A. https://inschool.adra.org/de [30.09.2020]
-
ADRA (2019): #EveryChildEverywhere Advocacy Campaign [YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=YPi01hBmuUc&t=5s
-
Advocates Children and Youth (2014, 14. August): What is Advocacy? [YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=0F_PxzLIIzQ
-
BOND (2005): The How and Why of Advocacy London, o.A.
-
Bündnis #unteilbar. (o.A.): Bündnis #Unteilbar [YouTube] https://www.youtube.com/channel/UCGOqF9BECPJVwyh4eEPMhjA [29.09.2020].
-
Bündnis #unteilbar, (2019, 30. April): #UNTEILBAR PODCAST 001 – Feminismus [online] www.unteilbar.org/001-feminismus/ [29.09.2020].
-
Bürger, Tobias (2015): Use of digital advocacy by German nonprofit foundations on Facebook. In: Public Relations Review 41 (4), S. 523–525.
-
Coulby, Hilary (2010): Advocacy Communications: A Handbook for ANEW Members, o.A.
-
Gisler, Stefan (o.A.): Ein Volk kämpft für seine Rechte, [online] https://www.heks.ch/sites/default/files/documents/2016-11/Advocacy-Arbeit%20Brasilien.pdf [29.09.2020].
-
Haq, Z.; Khan, W.; Rizwan, S. (2013): Advocacy, communication and social mobilisation for tuberculosis control in Pakistan: a qualitative case study. In: int j tuberc lung dis 17 (3), S. 394–399.
-
Huesca, Robert (2008): Tracing the History of Participatory Communication Approaches to Development: A Critical Appraisal, in: Servaes, Jan (Hrsg.), Communication for development and social change, 2. Auflage, Neu-Dehli: SAGE, S. 180-200.
-
Krisch, Franziska (2012): Wirkungsorientierung von Advocacy: Eine Handreichung für Planung, Monitoring und Evaluierung von Advocacy-Arbeit, hg. v. Diakonisches Werk der EKD e.V. für die Aktion “Brot für die Welt”, Stuttgart: o.A.
-
Malikhao, Patchanee & Servaes, Jan (2012): Advocacy communication for peacebuilding, in: Development in Practice, Jg. 22, Nr. 2, S. 229-243.
-
Neue deutsche organisationen e.V. (2020, 31. August): Expert*innenkreis zum Rassismus-Kabinett stellt Antirassismus Agenda 2025 vor: Wir brauchen einen politischen Neustart und keine halbherzigen Maßnahmen, [online] https://neuedeutsche.org/de/artikel/expertinnenkreis-zum-rassismus-kabinett-stellt-antirassismus-agenda-2025-vor-wir-brauchen-einen-po/ [29.09.2020].
-
Neue deutsche organisationen e.V., (o.A.): Kompetenznetzwerk Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft, [online] https://neuedeutsche.org/de/kompetenznetzwerk/ [29.09.2020].
-
NTP Pakistan - ACSM, TV Commercial -Akhter Qureshi ki Kahani (2008) https://www.youtube.com/watch?v=WHebGMDZpUs
-
NTP Pakistan - ACSM, TV Commercial - Sajid ki Kahani (2008) www.youtube.com/watch
-
NTP Pakistan - ACSM, TV Commercial - Hamida Ki Kahani (2008) www.youtube.com/watch
-
Oxfam Deutschland e.V., (o.A.): Mali: Langsame Rückkehr zur Demokratie (Projekt abgeschlossen), [online] https://www.oxfam.de/unsere-arbeit/projekte/mali-langsame-rueckkehr-demokratie-projekt-abgeschlossen [29.09.2020].
-
SoPact (2020) Theory of Change Outcome vs Output Foundation for Social Impact Measurement: https://www.youtube.com/watch?v=cg4J1g0IVHg
-
The Praxis Project: Planning for Media Advocacy, o.A. über www.thepraxisproject.org
-
Turk, Tahir; Newton, Fiona J.; Netwon, Joshua D.; Naureen, Farah; Bokhari, Jodah (2013): Evaluating the efficacy of tuberculosis Advocacy, Communication and Social Mobilization (ACSM) activities in Pakistan: a cross-sectional study. In: BMC public health 13, S. 887.
-
Wallack, Lawrence (1994): Media Advocacy: A Strategy for Empowering People and Communities, in: Journal of Public Health Policy, Jg. 15, Nr. 4, S. 268-277.
-
Wilkins, Karin Gwinn (2014): Advocacy Communication, in: Wilkins, Tufte & Obregon (Hrsg.), The Handbook of Development Communication and Social Change, John Wiley & Sons, Inc, S. 57-71