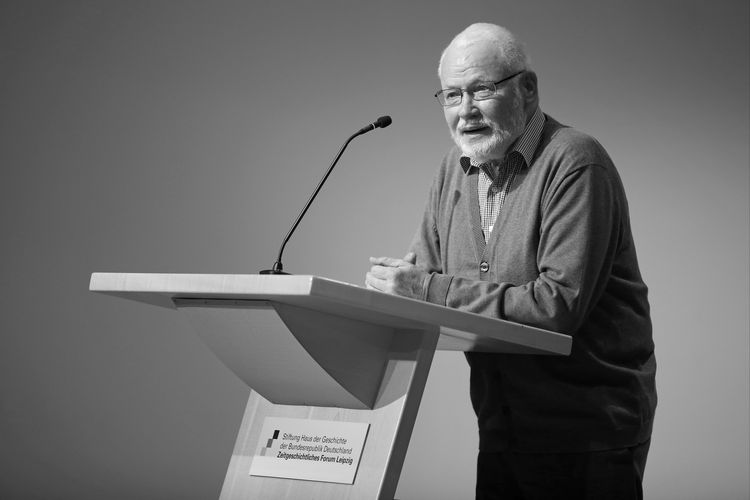Hans Poerschke ist in Berlin in einfachen Verhältnissen zur Welt gekommen. Sein Vater, der nicht aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, war Hausmeister und später Hilfsarbeiter in der Reichsdruckerei, seine Mutter war Näherin und hat ihre Familie nach dem Krieg mit Heimarbeit, als Erntehelferin und schließlich Gütekontrolleurin durchgebracht. Dank Stipendien im Rahmen der anfangs arbeiterfreundlichen Bildungspolitik der DDR, die später einer Selbstrekrutierung der privilegierten Funktionärsschicht wich, konnte er die Oberschule besuchen und hat – ungeachtet musikalischer Begabung – nach dem Abitur 1955 an der Fakultät für Journalistik der Karl-Marx-Universität Leipzig studiert. Das Studium schloss er 1959 mit einer Diplomarbeit über Analyse in journalistischen Beiträgen ab und kehrte – nach einer kurzen Zwischenphase als FDJ-Funktionär – an die Journalistik-Fakultät zurück. Die wurde von den Studierenden ironisch „rotes Kloster“ genannt, woraus später der Titel des Buchs wurde, mit dem Brigitte Klump pauschal mit der akademischen Einrichtung abgerechnet hat, in der die allermeisten Journalisten und Journalistinnen der DDR ausgebildet wurden. Unter dem Dekan (bzw. Sektionsdirektor) Emil Dusiška wurde Hans Poerschke 1969 mit einer Dissertation zum selbstgewählten Thema „des Begriffs der gesellschaftlichen Information in der Journalistikwissenschaft“ promoviert und stieg in der Folge zum Oberassistenten, Dozenten und nach der B-Promotion (entsprach der Habilitation) 1983 zum ordentlichen Professor und Leiter des Wissenschaftsbereichs Theorie und Geschichte des Journalismus auf.
Nach der Wende wurde Hans Poerschke von den Studierenden frei zum letzten Direktor der Leipziger Sektion Journalistik in der noch existierenden DDR gewählt, bevor er – im Rahmen der Evaluationen von Kurt Koszyk als „bedingt bildungsfähig“ eingestuft – unter dem Gründungsdekan Karl Friedrich Reimers 1991 das Studienprogramm Publizistik geleitet und in der Gründungskommission des neuen Instituts für Kommunikations- und Medienwissenschaft mitgewirkt hat. Da ihm klar war, dass er darin keinen Platz haben würde, hat er sich dort nicht mehr um eine Professur beworben und ist 1992, nachdem sein letzter Arbeitsvertrag ausgelaufen war, mit frischen 55 für fünf Jahre in den Altersübergang gegangen. Die damit verbundene materielle Sicherheit verschaffte ihm die Möglichkeit, im „Ruhestand“ wissenschaftlich, aber auch politisch und vor allem medienpolitisch aktiv zu bleiben: für die PDS in der Bundestags-Enquête-Kommission „Neue Medien“ und für sechs Jahre im Rundfunkrat des MDR. Außerdem hat er den Landesverband Sachsen des Deutschen Journalisten-Verbandes mitgegründet sowie (zusammen mit anderen früheren Mitgliedern der Leipziger Sektion Journalistik) den Verein „Diskurs“, der in Dresden über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme eine Arbeitslosenzeitung herausgab; er war Abgeordneter im Kreistag Anhalt-Bitterfeld und Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen; Ende der 1990er Jahre ist er einige Male der Einladung zu Lehraufträgen am Institut für Journalistik der Universität Dortmund gefolgt.
Hans Poerschke war vor allem deshalb ein vorbildlicher Wissenschaftler, weil er die selbstkritische Distanz zur eigenen Person mit ihren lebenspraktischen Interessen gewahrt hat, die es erlaubt, sich Irrtümer einzugestehen und problematische Positionen zu korrigieren. Nicht aufgegeben hat er dabei den ideologiekritischen Gedanken an die Möglichkeit falschen, dem Sein der Verhältnisse nicht angemessenen Bewusstseins. Gut möglich, dass es ihm nicht gefallen hätte, aber man kann darin die von Karl Popper empfohlene Methode des mühsamen wissenschaftlichen Voranschreitens durch Falsifikationsbemühungen sehen.
Für Hans Poerschke war ein wichtiger Gegenstand seines Erkenntnisfortschritts die Auffassung, die Lenin von Parteipresse und Journalismus gehabt hat. 1983 erschien das von einem Autorenkollektiv unter seiner Leitung verfasste, für die damalige Leipziger Journalistik maßgebliche Grundlagenwerk. Darin hat er Lenin mit kräftigem Beifall zu Wort kommen lassen: „Nur die Schaffung eines gemeinsamen Parteiorgans kann jeden ‚Teilarbeiter‘ der revolutionären Sache mit dem Bewußtsein erfüllen, daß er ‚in Reih und Glied‘ marschiert, daß seine Arbeit für die Partei unmittelbar notwendig ist, daß er ein Glied jener Kette bildet, die den schlimmsten Feind des russischen Proletariats […] erdrosseln wird“.[1] Der hier und an vielen anderen Stellen, z. B. der berüchtigten, oft zitierten Aufgabenbeschreibung für Journalisten als kollektiven Propagandisten, Agitatoren und Organisatoren zum Ausdruck kommende diktatorische Charakter der Auffassungen Lenins wurde von Poerschke und seiner Umgebung zu dieser Zeit gern mit vorübergehenden taktischen Notwendigkeiten erklärt, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts aus der Entwicklung der sozialistischen Parteipresse im zaristischen Russland ergaben.
Ende 1988, unter dem Vorzeichen der Perestroika Gorbatschows und angesichts des sozioökonomischen Verfalls der DDR, der ein Jahr später zur Wende führte, wurde ein Manuskript Hans Poerschkes in der Sektion Journalistik vervielfältigt und verteilt, in dem kaum noch, wie zuvor, vom Herstellen öffentlicher Meinung, sondern nun von Öffentlichkeit als Aufgabe des Journalismus die Rede war. Er hat darin die journalistische Arbeit als den Weg beschrieben, wie aktuelle gesellschaftliche Probleme, noch etwas allgemein und verklausuliert mit dem Begriff der „aktuellen gesellschaftlichen Situation“ gefasst, durch ihre Bekanntgabe der Bearbeitung und Veränderung zugeführt werden (können): „Aneignung der aktuellen gesellschaftlichen Situation [durch den sozialistischen Journalismus] als Handlungssituation des Volkes verlangt nicht nur, Möglichkeiten und Erfordernisse aufzudecken und zu bewerten, die sich aus dieser Situation für sein [des Volkes] weiteres Handeln ergeben, sondern auch, konkrete Ziele und Mittel für die Nutzung der Möglichkeiten und die Berücksichtigung der Erfordernisse zu unterbreiten und zu erörtern“.[2] In den Quellenangaben der getrennt voneinander gehefteten Kapitel des Manuskripts tauchen nun Schriften von Karl Marx, einem Vorkämpfer der Pressefreiheit in Deutschland, vermehrt auf.
Nach der Wende hat Hans Poerschke deutlicher den Wandel der Auffassungen von Öffentlichkeit in den letzten Jahren der DDR aus Schriften von Michael Brie, Wolfgang Luutz und sich selber rekonstruiert. In einem Aufsatz von 2010 ist zu lesen: „War früher die Führung der Gesellschaft durch die Partei, ihre Leitung durch den Staat, das Hineintragen sozialistischen Bewusstseins in die Massen der Ausgangspunkt für die Betrachtung der Öffentlichkeit, gewann nun eine neue Betrachtungsweise den Vorrang. Öffentlichkeit wurde nun durchgängig als ‚Verkehrsform‘, als ‚eine gesellschaftliche Form sozialer Kommunikation‘, als ‚gesellschaftliche Kommunikationsweise‘ begriffen, die zu den Bedingungen gesellschaftlicher Existenz der Menschen in der modernen Gesellschaft gehört und von deren Funktionieren es abhängt, ob und wie diese ihr Zusammenleben gestalten können.“[3]
Hans Poerschke hat auch wieder die Auffassungen von Parteipresse und Journalismus untersucht, die Lenin in seinen zahlreichen Schriften geäußert hat. In seinem 2020 erschienenen Buch dazu hat er Lenins Journalismuskonzept als von Anfang bis Ende öffentlichkeitsfeindlich und repressiv erkannt und scharf kritisiert: „Das von Lenin inspirierte und unter seiner Führung verwirklichte Regime des Umgangs der Partei mit der Presse war durch und durch undemokratisch. Das war kein behebbarer, fehlender Erfahrung oder widrigen Umständen geschuldeter Mangel. Vielmehr konnte nur ein umfassendes System geistiger und politischer Knebelung und Gängelung des Volkes die von einer Parteielite diktatorisch ausgeübte Macht sichern. Das Prinzip der Parteiliteratur zerstörte – wie auch alle anderen Seiten der Herrschaft der Partei Lenins – die Voraussetzungen für die Erreichung des emanzipatorischen Ziels, unter dem die Partei angetreten war. […] Unter Lenin wurde die Praxis der Reglementierung etabliert, Stalin konnte sich auf sie als eine unbestreitbare Selbstverständlichkeit stützen:“[4]
Hans Poerschke ist in einem langen und gründlichen Forschungsprozess zu dieser Einsicht gelangt. Das ist ihm nicht leicht gefallen, er hat bei Podiumsdiskussionen von seinem Unbehagen gesprochen, aufgrund besserer Einsicht den jüngeren Mann verraten zu müssen, der er selbst gewesen ist. Mit ihm verlieren Kommunikationswissenschaft und Journalistik einen Kollegen, der den „Beruf zur Wissenschaft“ verkörpert hat wie kaum ein anderer. Dass er im deutschen Hochschulwesen nach der Wiedervereinigung keinen Platz gefunden hat, spricht ebenso gegen dessen pluralistische Vielfalt wie der Umstand, dass seine Universität sich in den 1990er Jahren des Namens von Karl Marx geschämt und entledigt hat. Auch deshalb sollten wir den redlichen Marxisten Hans Poerschke in lebendiger und ehrender Erinnerung behalten. Er – und wir mit ihm – haben es verdient.
Horst Pöttker
Über den Autor:
Prof. Dr. Horst Pöttker ist Professor i.R. für Journalistik an der Technischen Universität Dortmund. Er war von 1992 bis 1995 Gastprofessor in Leipzig und hat sich intensiv mit Forschung und Lehre der DDR-Journalistik befasst.
Quellen:
[1] Poerschke, Hans u. a. (1983): Theoretische Grundfragen des sozialistischen Journalismus. Leipzig: Karl-Marx-Universität, Sektion Journalistik, S. 36f.
[2] Poerschke, Hans (1988): Sozialistischer Journalismus. Ein Abriß seiner theoretischen Grundlagen. Kapitel 3: Der journalistische Gegenstand im Prozeß seiner Aneignung. Abschnitt 3.1: Erschließung der aktuellen Situation. Leipzig: Karl-Marx-Universität, Sektion Journalistik (Manuskriptdruck), S. 158.
[3] Poerschke, Hans (2010): Öffentlichkeit als Gegenstand gesellschaftswissenschaftlicher Diskussion in der DDR. In: Eberwein, Tobias / Müller, Daniel (Hrsg.): Journalismus und Öffentlichkeit. Eine Profession und ihr gesellschaftlicher Auftrag. Festschrift für Horst Pöttker. Wiesbaden: VS, S. 43-56, S. 49.
[4] Poerschke, Hans (2020): Das Prinzip der Parteiliteratur. Partei und Presse bei und unter Lenin 1899 – 1924. Köln: Herbert von Halem, S. 216.